Religion wird in Kriegen und Konflikten oft als treibende Kraft für Gewalt wahrgenommen. Sie kann aber auch ganz anders wirken: Wir stellen sieben Beispiele vor, die zeigen, wie sich Gläubige und religiöse Gemeinschaften für Frieden eingesetzt haben.
Diesen Artikel aus unserem Printmagazin „Wege zum Frieden“ und weitere exklusive Beiträge gibt’s im GNM+ Abo.
Unsere ePaper hier im Abo oder hier mit tiun ohne Abo lesen.
„Gott ist gefährlich“ – das sagt zumindest der Soziologe Ulrich Beck. Auf den ersten Blick scheint das zu stimmen, denn oft wird Religion als Auslöser für Gewalt und Kriege gesehen. Doch laut der Bertelsmann-Stiftung sind nur elf Prozent der Kriege tatsächlich auf religiöse Ursachen zurückzuführen. Stattdessen geht es meistens um die Verteilung von Ressourcen, Landbesitz und Macht. Wenn Kriege aber religiös aufgeladen werden, lassen sich Menschen oft leichter von ihrer Notwendigkeit überzeugen – denn wenn es plötzlich um „Gut gegen Böse“ geht, kann selbst Gewalt besser gerechtfertigt werden. Wie jede Ideologie wird Religion in den falschen Händen dann zum Instrument für Unterdrückung oder zum Argument für gewaltvolle Vergeltung – ganz nach dem Motto “Auge um Auge, Zahn um Zahn”.
Aber genau diese Kraft, Menschen zu bewegen, kann auch anders eingesetzt werden. Religion kann Gemeinschaften zusammenbringen und motivieren, sich für das zu engagieren, was alle großen Glaubensrichtungen eben auch lehren: Frieden und Versöhnung. Im Christentum wird das zum Beispiel durch das fünfte Gebot „Du sollst nicht töten“ deutlich. Auch der Koran betont die Wichtigkeit des Friedens, etwa in der Sure 42:40: „Und wer vergibt und Versöhnung stiftet, dessen Lohn ist bei Allah“. Im Hinduismus, Jainismus und Buddhismus ist “Ahimsa” (Gewaltlosigkeit) eines der wichtigsten Prinzipien und findet sich in vielen zentralen Schriften. Doch wie können diese Lehren in die Tat umgesetzt werden? Das zeigen unsere Beispiele aus der ganzen Welt.
1. Nach dem Terror
Der Mönch Maha Ghosananda brachte den Buddhismus zurück nach Kambodscha – und mit ihm eine Friedensbewegung, die das gesamte Land durchzog. In den 1970er Jahren wurde Kambodscha von den Roten Khmer unter dem Diktator Pol Pot regiert. Der Schreckensherrschaft fielen rund zwei Millionen Menschen zum Opfer, etwa ein Viertel der Bevölkerung. Pol Pot verbot unter anderem die Ausübung von Religion, zerstörte Klöster und religiöse Texte. Maha Ghosananda absolvierte zur Zeit der Roten Khmer seine Ausbildung als buddhistischer Gelehrter in Indien.
Nach dem Zerfall des Regimes kehrte er nach Kambodscha zurück und veranstaltete in den 90er Jahren jährliche „Friedensmärsche“. Gemeinsam mit hunderten Anhänger:innen setzte er sich so für die Zerstörung von Landminen, für die Teilnahme an demokratischen Wahlen, für Umweltschutz und für eine Versöhnung mit den Roten Khmer ein.
2. Gebete und Blumen gegen Panzer
Ferdinand E. Marcos regierte die Philippinen 21 Jahre lang als Diktator. Seine Absetzung im Jahr 1986 ging als „Rosenkranz-Revolution“ in die Geschichte ein, denn dabei spielte auch die katholische Kirche eine entscheidende Rolle.
Auf internationalen Druck setzte Marcos im Februar 1986 kurzfristig Neuwahlen an. Doch nach Berichten über Wahlbetrug kam es einige Tage später zu einem Wendepunkt: Teile des Militärs forderten Marcos‘ Rücktritt und verschanzten sich auf einer Militärbasis. Kardinal Jaime Lachica Sin rief daraufhin die Bevölkerung auf, den Soldaten Schutz zu bieten und Nahrung zu bringen, was sofort geschah. Marcos befahl seinen Einheiten schließlich, das Camp zurückzuerobern.
Als Panzer in Richtung des Lagers vorrückten, strömten unzählige Zivilist:innen auf die Straßen, darunter viele Nonnen und Priester. Sie stellten sich den Panzern unbewaffnet entgegen, beteten den Rosenkranz, sangen und boten den Soldaten Brot und Blumen an. Angesichts des gewaltlosen Widerstands verweigerten die Marcos-treuen Einheiten den Befehl, einige wechselten sogar die Seiten – die jahrzehntelange Herrschaft des Diktators war zerfallen.
3. Fatwas für den Frieden
Die Imam-Ali-Moschee im irakischen Nadschaf ist ein beeindruckendes, goldenes Gebäude – und eines der wichtigsten Heiligtümer der Schiiten. Nach den Sunniten sind die Schiiten die größte islamische Glaubensgruppe und machen rund 15 Prozent der Gläubigen aus. Die Spaltung der beiden Konfessionen entstand nach dem Tod des Propheten Mohammed und aus der Frage, wer sein rechtmäßiger Nachfolger werden soll.
Die Imam-Ali-Moschee war 2004 Schauplatz wochenlanger Kämpfe zwischen einer schiitischen Miliz und dem US-Militär. Als sich die irakischen Truppen schließlich in der Moschee verschanzten, stand ein Sturm der US-Amerikaner auf das Heiligtum kurz bevor. Doch der Konflikt konnte durch den Religionsführer der irakischen Schiiten beendet werden. Der Großajatollah Ali Al-Sistani sprach Fatwas (religiöse Gutachten) gegen die Anwendung von Gewalt aus und bewegte Tausende seiner Anhänger zu einem Friedensmarsch zur Moschee. Daraufhin zog sich die schiitische Miliz aus der Moschee zurück und das US-Militär brach seinen Angriff ab.
4. In letzter Sekunde
Der Plan stand fest: Am 22. Dezember 1978 waren argentinische Flotten auf dem Weg, um drei Inseln vor Feuerland zu besetzen. Damit wäre der Konflikt eskaliert, in dem sich Argentinien und Chile seit Jahrzehnten befanden. Beide Länder erhoben Anspruch auf die Inseln Lennox, Picton und Nueva. Kurz bevor der Angriff stattfinden sollte, schaltete sich Papst Johannes Paul II. ein. Er telefonierte mit dem chilenischen Diktator Augusto Pinochet und dem argentinischen Diktator Jorge Rafael Videla. Sein Aufruf zum Frieden zeigte Wirkung – die Flotte drehte um und ein Krieg konnte verhindert werden.
1984 unterschrieben die Außenminister beider Länder schließlich einen Friedens- und Freundschaftsvertrag. Er sprach die drei Inseln Chile zu, das umliegende Meer ging an Argentinien.
5. Gewaltloser Regimewechsel
Ende der 1980er Jahre kam es zu Unruhen in der Bevölkerung von Benin: Die wirtschaftliche Lage war schlecht und die Menschen waren unzufrieden mit dem kommunistischen Regime. Um einen friedlichen Machtwechsel einzuleiten, berief der katholische Erzbischof Isidore de Souza 1989 eine Nationalkonferenz ein. An ihr nahmen rund 500 Delegierte aus verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Gruppierungen des Landes teil. Die Versammlung war ein Erfolg und leitete den friedlichen Übergang zu einem demokratischen Staat ein.
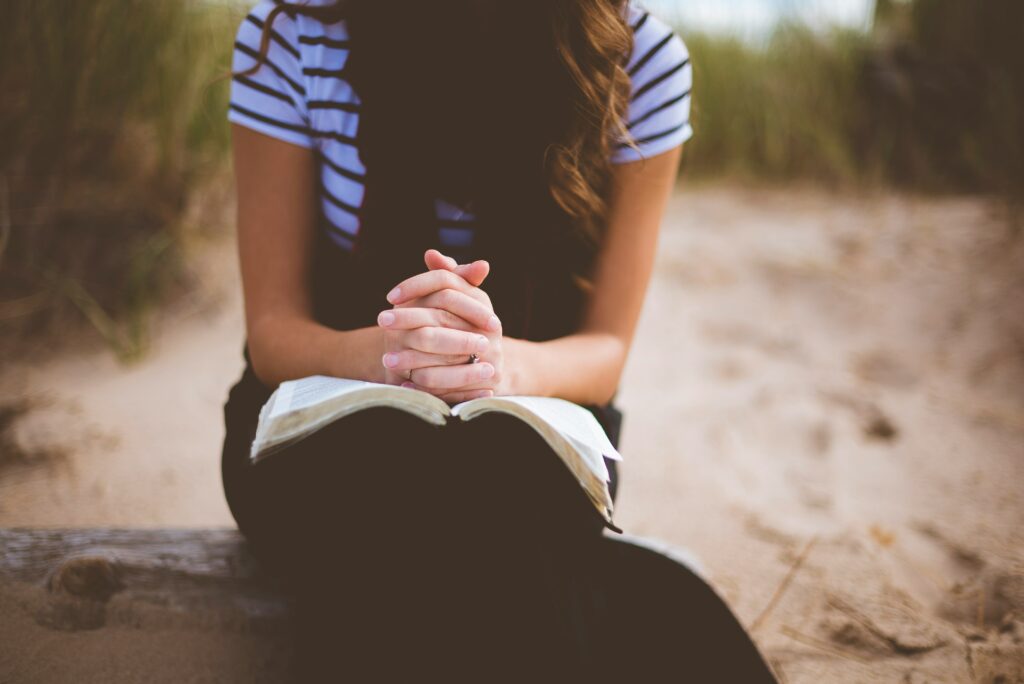
6. Eine Gemeinschaft für den Frieden
Die katholische Gemeinschaft Sant’Egidio hat geschafft, was den Vereinten Nationen nicht gelungen ist: Sie half dabei, den Bürgerkrieg in Mosambik zu beenden. Der Konflikt begann 1977, zwei Jahre, nachdem das ostafrikanische Land seine Unabhängigkeit von Portugal erlangt hatte. Die Regierungspartei Frelimo, die das Land kommunistisch regieren wollte, kämpfte gegen die Rebellengruppe Renamo, die die neue Politik gewaltsam ablehnte.
Angesichts der verheerenden Auswirkungen des Konflikts auf die Bevölkerung vor Ort schickte Sant’Egidio Nahrungsmittel und Medikamente nach Mosambik. Dadurch konnte die Gemeinschaft das Vertrauen sowohl der Regierung als auch der Rebellen gewinnen. Sie schlug beiden Parteien Friedensverhandlungen vor, die im Jahr 1990 im Kloster von Sant’Egidio in Rom begannen. Mit Erfolg: Zwei Jahre später unterzeichneten Präsident Chissano und der Rebellenführer Dhlakama einen Friedensvertrag. In den darauffolgenden Jahren setzte sich die Gemeinschaft Sant’Egidio außerdem für Friedensverhandlungen in Guinea, Côte d’Ivoire und der Zentralafrikanischen Republik ein.
7. Frieden durch Dialog
Dekha Ibrahim Abdi wurde 1964 im kenianischen Wajir an der Grenze zu Somalia geboren. Ihre Kindheit war geprägt von einem gewaltvollen Konflikt zwischen der kenianischen Regierung und somalischen Rebellen, die die Region abspalten wollten. Auch nach Ende des Krieges kam es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den Konfliktparteien und verschiedenen lokalen Gruppen.
In den 1990er Jahren gründete die Muslima deshalb zusammen mit anderen Frauen einen Nothilfeausschuss, dem muslimische und christliche Frauen angehörten. Sie organisierten gemeinsame Gebete und begannen, kleinere Konflikte in ihrer Gemeinde zu schlichten. 1992 führte Dekha Ibrahim Abdi schließlich eine größere Friedensinitiative an, die Menschen verschiedener Gruppen, Religionen und Ethnien zusammenbrachte. Trotz Widerstände der Ältesten erreichten sie ein Friedensabkommen und gründeten das Wajir Peace Committee, an dem unter anderem Personen aus lokalen Regierungen, Religionsgemeinschaften und Nichtregierungsorganisationen teilnahmen.
Heute gibt es ähnliche Komitees in ganz Kenia und sogar in Somalia, Uganda, Äthiopien, dem Sudan und Südafrika. 2007 wurde Dekha Ibrahim Abdi für ihre Arbeit der Alternative Nobelpreis verliehen.


