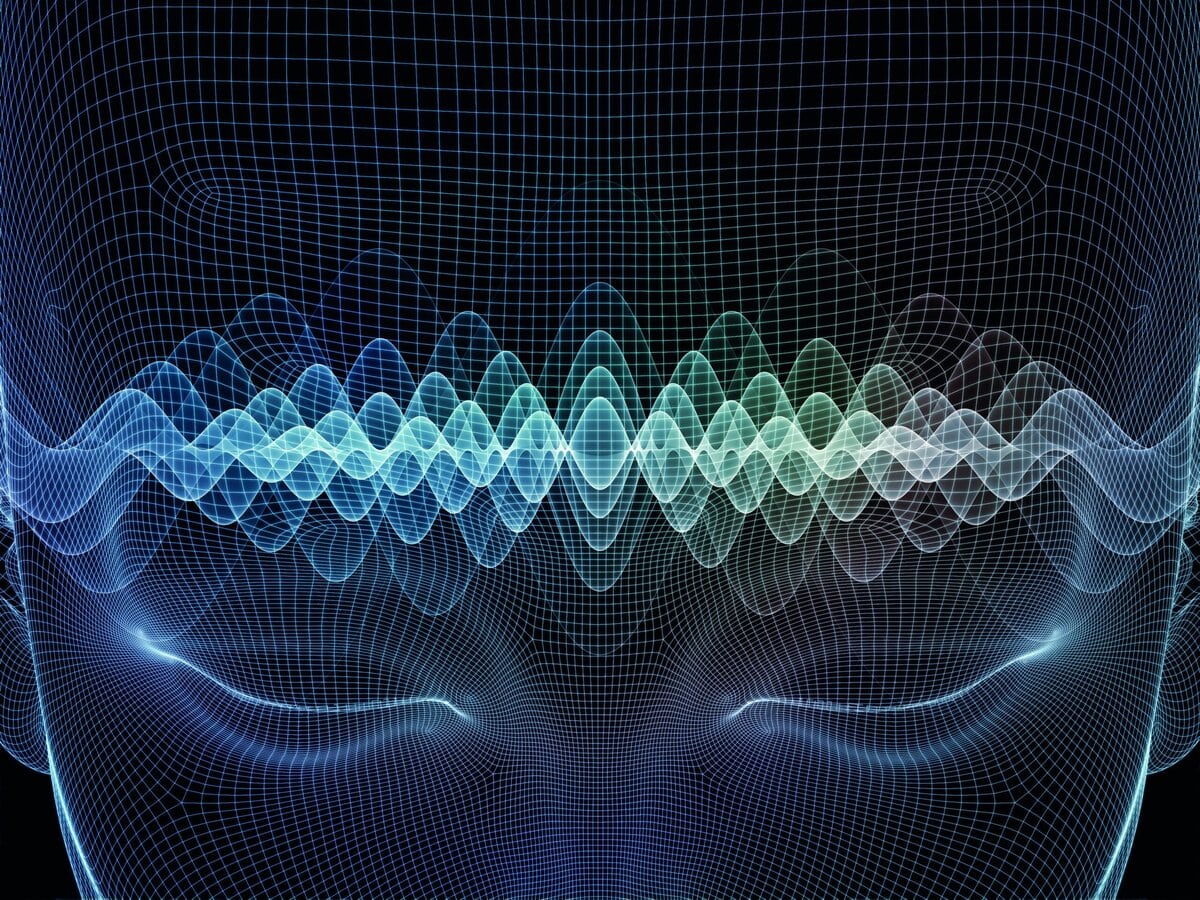Da KI kein passives Werkzeug ist wie bisherige technische Innovationen, braucht es mehr Medienkompetenz und gesellschaftliche Zusammenarbeit denn je zuvor. Die gute Nachricht: Es gibt bereits viele Lösungen und engagierte Menschen, die an sinnvollen Regeln für und gesellschaftlicher Innovation durch Künstliche Intelligenz arbeiten. Ein Interview mit Brancheninsider Fabian Linder von DeepVA.
Diesen Artikel aus unserem Printmagazin „Irgendwas mit Medien“ und weitere Vorteile gibt’s im GNM+ Abo. Unsere ePaper hier lesen.
Artikel anhören; 20:36 Minuten (für Mitglieder)
Sie wurden gewarnt. Ihre Reise führe auf direktem Wege in die Hölle, mahnte ein Pfarrer. Ärzte prognostizierten furchtbare Gehirnkrankheiten oder eine Lungenentzündung vom Fahrtwind . Und tatsächlich, an den 200 geladenen Fahrgästen der „Adler“ flog die Welt vorbei. Dabei fuhr die englische Dampflokomotive im Schnitt unter 30 km/h. Am 7. Dezember 1835 war damit die erste deutsche Eisenbahnverbindung auf der Strecke von Nürnberg nach Fürth eröffnet. Heute hat das Streckennetz der Deutschen Bahn eine Länge von mehr als 37.000 km.
Ob unsereins später auch in den Geschichtsbüchern belächelt werden wird, wenn kommende Generationen von unseren ersten Berührungspunkten mit Künstlicher Intelligenz lernen? Wie die Eisenbahn im 19 Jahrhundert ist heute KI ein Medium, das unser Leben transformiert. Eine neue Art der Informationsvermittlung sorgt dafür, dass alle Gesellschaftsbereiche, von Wirtschaft über Politik bis hin zur Kunst, im Umbruch sind. Im 21. Jahrhundert befindet sich die Welt in demselben Geschwindigkeitsrausch, der damals die Industrialisierung vorantrieb und der in einem Wimpernschlag neue Heilmittel und Krankheiten, neue Kommunikationswege und Möglichkeiten der Spaltung hervorbringt.
Dystopie als Popkultur
Ganz falsch lagen die Skeptiker damals nicht mit ihrer Einschätzung, die Dampfloks würden das Vieh vergiften, die Fuhrleute ihre Arbeitsplätze kosten und Erschöpfung durch Zeitdruck bringen. Wie damals bei der Eisenbahn fürchten Skeptiker:innen der KI heute Konsequenzen wie Umweltzerstörung, Arbeitsplatzverluste und medizinische Leiden.
Tatsächlich hat kaum eine Innovation so viel dystopisches Potential wie künstliche Intelligenz. Bereits 1927 landete Fritz Lang mit “Metropolis”, basierend auf dem gleichnamigen Science-Fiction-Roman der Schriftstellerin Thea Gabriele von Harbou, einen Kinohit. Der Stummfilm zeichnet eine düstere Zukunft, in der Maschinen regieren. Ähnliche Szenarien in Kassenschlagern wie Blade Runner, The Terminator und Matrix prägen seit Anfang der 80er Jahre unsere Wahrnehmung und verleihen der Angst vor Kontrollverlust und Endzeitszenarien durch künstliche Intelligenz Kultstatus.
Die in der Popkultur gezeichneten Zukunftsvisionen, in denen KI die Welt regiert, sind so etabliert wie dystopisch. Doch sie schufen eine Faszination für künstliche Intelligenz, auf die Firmen wie Open AI bei ihrem Marketing für neue Anwendungen mit vollmundigen Versprechen aufbauen konnten. Tatsächlich schaffte und schafft der medial befeuerte Hype um KI schnell neue Möglichkeiten, aber auch eine Reihe Herausforderungen für die Gesellschaft.
Für die Utopie braucht es klare Regeln
Es wird hitzig diskutiert, ob am Ende so heiß gegessen werden wird, wie gekocht wurde. Bisher halten sich, wie bei jeder technischen Innovation, die Chancen und Risiken wohl in der Waagschale. Richtig ist aber auch, dass KI die erste Technologie ist, die das Potential hat, ganz ohne Menschen auszukommen. Bereits jetzt wird KI im Alltag großflächig zur Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten eingesetzt. Mal denkt sie für uns, wenn sie Ausflugsziele für den Urlaub in der Landessprache recherchiert, mal übernimmt sie unseren kreativen Ausdruck, wenn sie die Geburtstagskarte entwirft und gleich den Text dafür mitformuliert. Anders gesagt: Die Dystopie ist schon längst Teil unserer Realität.
Nicht umsonst warnen Koryphäen wie der Informatiker und Psychologe Geoffrey Hinton, der als einer der Pioniere künstlicher Intelligenz den Nobelpreis in Physik für seine Arbeiten zu künstlichen neuronalen Netzen erhielt, vor einer Verselbststän…
 „KI-Harald“: Utopie fängt im Kleinen an
„KI-Harald“: Utopie fängt im Kleinen an